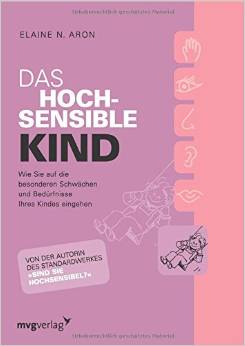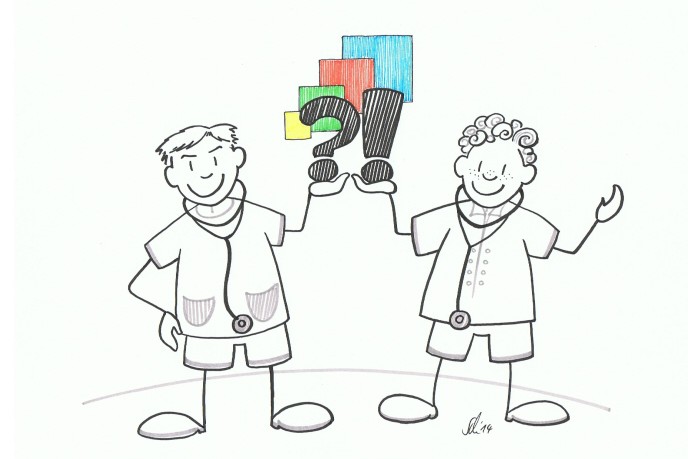Wie groß wird mein Kind?
Klar! Die Endgröße wird durch die Eltern bestimmt. Zwei Riesen werden kaum einen Zwerg groß ziehen und umgekehrt. Also ist Größe genetisch bestimmt? Oder gibt es andere Faktoren? Ja. Wenn die Lebensbedingungen (z.B. Mangelernährung) oder Krankheiten dies nicht ungünstig beeinflussen dann steckt die Endgröße in den Genen. Es werden allerdings immer mehr Gene gefunden, die einen Beitrag zur Endgröße leisten, zuletzt in einer vielbeachteten aktuellen Studie in Nature Genetics. Es wurden darin 423 Einzelgene gefunden die Einfluss auf die Endgröße haben. Welches der vielen Gene wie stark wirksam ist, weiß allerdings noch niemand. Was man in der Summe etwa abschätzen kann, ist also immer noch recht ungenau: Wir wissen lediglich, dass 90% der Kinder die Spanne von +/- 7,5cm um die folgende erwartete Größe erreichen: Für Mädchen: [(Vatersgröße + Muttergröße) : 2] – 6,5cm Für Jungs: [(Vatersgröße + Muttergröße) : 2] + 6,5cm Was, wenn man es noch genauer wissen will? Die Kinderärzte verraten: Bei Verdacht auf eine zu große oder zu kleine Endgröße kann man diese ab dem Grundschulalter von ca. 8 Jahren durch …